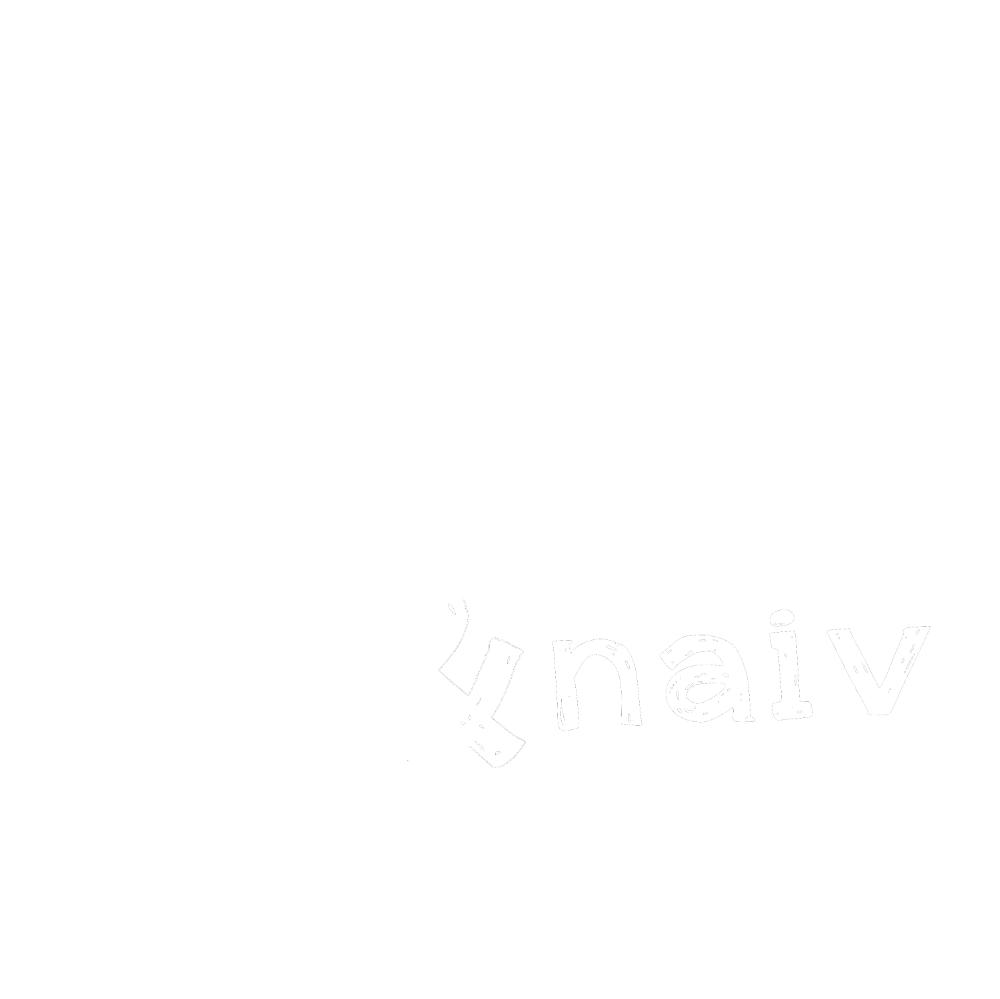Was passiert, wenn die Wähler der AfD sehen, dass die AfD ihre Versprechen nicht hält? Wählen sie dann eine noch rechtsextremere Partei?
Beiträge von JonnyMadFox
-
-
https://www.ardmediathek.de/vi…N3ci5kZS9hZXgvbzExNjgxNjA
Personalmangel der Schaffner bei der Bundesbahn 1964
-
Wieder das Narrativ von Personalmangel

Ich muss mal eine Sammlung machen von diesen alten Berichten zum Thema Wirtschaft und wie oft da von Arbeitskräftemangel gesprochen wird. Das ist ein Dauerthema über die Jahrzehnte hinweg

-
Heitmeyer ist, unter anderem, Herausgeber der Langzeitstudie Deutsche Zustände
-
Edit: sorry bin zu müde.
Hm ok 🤔gute nacht
-
Uns brennt die Hütte ja noch nicht weg, deswegen ändern wir nicht viel und auch nicht sofort.

Die Auflagen sind halt nicht sozial gerecht gestaltet. Man kann nicht einfach weitreichende Reformen durchpeitschen. Man hätte neue Reformen mit den Bauern zusammen erarbeiten sollen.
-
Transformationsräte ✌️
Selbst noch nicht angeschaut, hoffe es ist ganz gut

Mit Sabine Nuss
-
Hey, ich habe das Interview durch eine Auto-Transkription gezogen. Die ist relativ gut, aber im Detail auch relativ schlecht geworden. Zunächst mal sind nur Sätze in einzelne Paragraphen abgegrenzt, an vielen Stellen fehlt das Dazwischengeredete des jeweiligen Gegenüber, beispielsweise "Paragraph 218" von Tilo bei Abtreibung.
Es wäre gut, wenn sich jeweils jemand findet, der sich einen Abschnitt sucht und die Sprecher in diesem Abschnitt zuordnet und grobe inhaltliche Fehler korrigiert. Die Abschnitte habe ich nach Youtube Segmenten untergliedert und auch die entsprechenden Einsprung Links für Youtube eingefügt. Wer ein Segment korrigiert hat, kann es einfach hier unten im Chat einfügen. So und hier das Interview als KI-Autotranskript im AnhangVon KI? Hast mal drübergeschaut, ob alles einigermaßen korrekt ist. Oder kann man gleich alles neu machen?
-
Naja das mit den Wochenendpendlern ist schon cherry-picking. Es ist klar, dass es immer Leute geben wird, die einen Nachteil haben. Das ist bei jedem politischen Vorhaben so.
-
Jo. Stehen lassen ist kein Verbot und die Innenstadt ist nicht Deutschland.
Mach doch mal eine Stichprobe auf deutschen Autobahnen an einem Sonntag, wieviele davon Pendler sind. Jahrzehntelanger Umbau der
WirtschaftsInfrastrukturen zur maximalen Ausbeutung mittels Arbeitnehmerfreizügigkeit kann man sicher nicht im Handstreich beenden, ohne massiven Schaden anzurichten. Der Effizienzgewinn in vielen Bereichen ist Folge von energiegetriebener Mobilitätsmaximierung. Infrastruktur, z.B. Behörden, Kinos, Krankenhäuser usw. konnten nur deshalb widerstandsloswegrationalisiertzentralisiert werden. Das lässt sich mit ÖPNV außerhalb der Ballungszentren auch nicht lösen, zumal man auch bein Nahverkehr genug Rückbau betrieben hat.Sowas kann man mal unkonkret um-fragen und bekommt dann passende Ergebnisse, besonders, wenn die Befragten sich die Konsequenzen noch nicht wirklich haben durch den Kopf gehen lassen.
Es geht hier um ein Fahrverbot am Sonntag und nicht um dauerhaftes Fahrverbot.
-
https://www.ardmediathek.de/se…3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMzA1
SWR Retro – Report Chronik
Das ARD Politikmagazin des Südfunk Stuttgart, erstmals ausgestrahlt am 25.04.1961 unter dem Titel „Anno – Filmberichte zu Nachrichten von gestern und morgen“. Im Wechsel produziert vom SDR bzw. BR – historischer Vorläufer von „Report Mainz“.
Mehr anzeigen
Alle Videos zum anschauen

-
-
Äh ja. Da geht es um das, was er in China gemacht hat. Aber zu sagen, er wäre Spion ist doch nur wieder ein sensationsgeiler bullshit. Oder glaubst du, dass er Spion für die Regierung in China ist? Oder für Russland oder wen auch immer.
-
Das war 1973, da hatten keine 20 % der Bundesbürger überhaupt ein Kfz (heute über 60).
Dementsprechend arbeitete die Mehrheit der Menschen auch in nächster Umgebung ihres Wohnortes und auch Einkaufsmöglichkeiten etc. waren auf diese Umstände ausgerichtet.
Du vergleichst hier zwei völlig verschiedene Welten.
-
Was soll dieses Dummgeschwätz davon, dass Krah ein Spion von China ist? 😅Wer denkt sich diesen Schwachsinn aus?
-
Es gab in Deutschland mal ein Fahrverbot Sonntags, während der Ölkrise. Die meisten Deutschen würden auch heute nix dagegen haben denk ich.
-
https://corpgov.law.harvard.edu/
https://www.ardmediathek.de/vi…N3ci5kZS9hZXgvbzE0NzE5ODY
1:19:00 Gesetzschleicher👌😅
https://www.ardmediathek.de/vi…N3ci5kZS9hZXgvbzE0MzU5NzQ
Partei der Nichtwähler 1965

-
-
Denke, dass das halt Wahlmanipulation durch Microtargeting ist 🤷🏼 Man präsentiert jeweils ein Video mit passender politischer Message der Gruppe mit den passenden politischen Präferenzen. Ob die AfD das dann wirklich zum politischen Programm hat, spielt keine Rolle, die lügen einfach. Und das können sie auch so machen, weil es ja nicht reguliert und überwacht wird. Und das schlimmste daran ist: Man kann es aussehen lassen als würden die Jugendlichen tatsächlich AfD Positionen vertreten. Genau das gleiche Phänomen war doch auch mit der FDP 😅als sie tiktok Videos gemacht hat. Fällt einem nichts dazu ein? Oder was?
Die FDP wird bei der nächsten Bundestagswahl auch wieder Microtargeting auf social-media machen und dann viel jugendliche Wähler haben. Die faken einfach ihre politischen Werbeclips 🤷🏼
Die parlamentarisch-repräsentative Demokratie ist jetzt komplett am Arsch😅
-
Wie Microtargeting funktioniert.