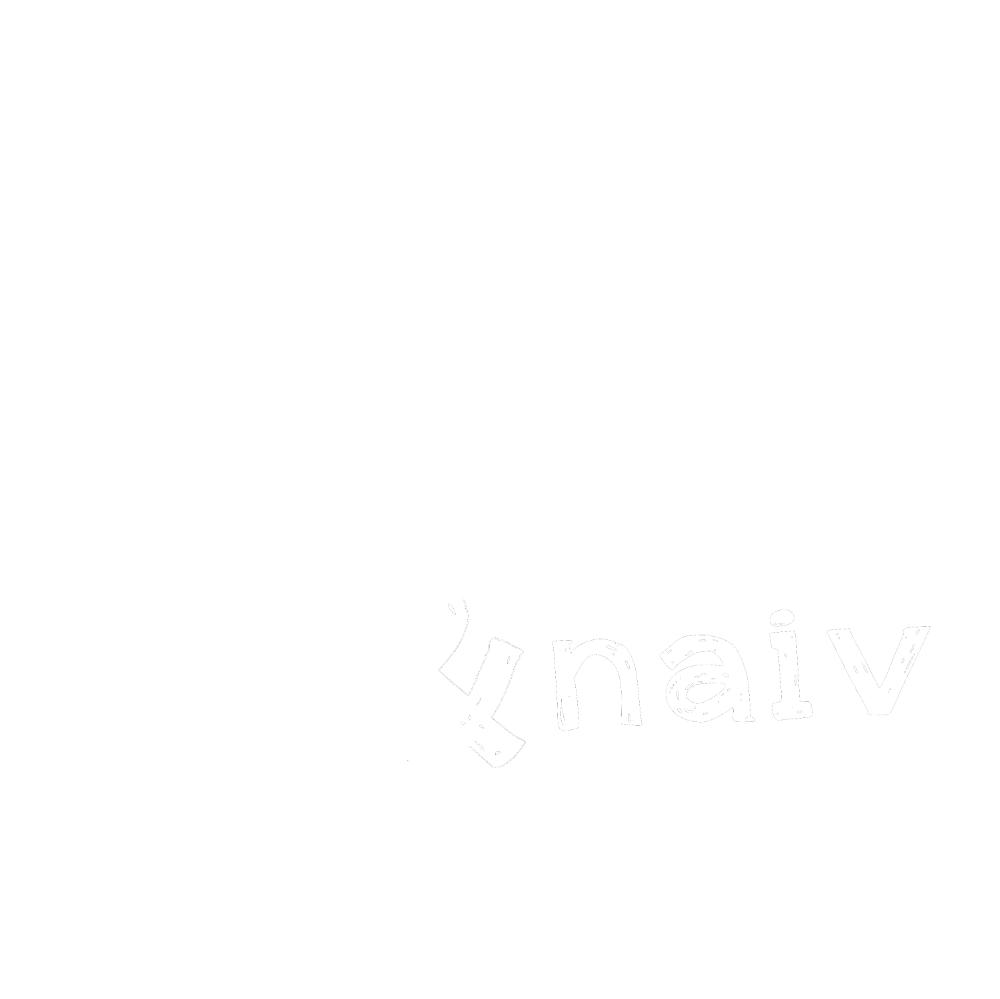Das ist sicher richtig. Und genau deshalb eine der Schwächen des Buchs.
Was die Autoren von „Gekränkte Freiheit“ nämlich offenkundig nicht verstehen (und das ist angesichts der Tatsache, dass sie Soziologen sind, umso frappierender) ist, dass nun in Deutschland (und auch in Österreich) Prozesse einen Höhepunkt erreicht haben, die etwa in Frankreich schon seit vielen Jahren diskutiert werden: die Entfremdung der Menschen, vielfach vor allem benachteiligter Personengruppen, von den „linken“ Parteien, der Verlust einer politischen Heimat und die potenzielle Vereinnahmung dieses Unmutes vonseiten rechter oder rechtspopulistischen Parteien.
Nicht aber, weil sich die Menschen radikalisieren oder allesamt verkappte „Nazis“ sind, rücken sie näher zu rechten Parteien, sondern weil sie sich von den linken und grünen Politikern weder vertreten noch repräsentiert fühlenund den Eindruck haben, dass hier linke Eliten – der
Wäre doch so einfach. Diese sogenannten "linken Parteien", hätten sich halt "Einwanderungs-Stop 2015" oder "Deutschland den Deutschen" oder "Hängt Merkel auf" auf die linken Fahnen/Plakate schreiben müssen, dann hätte der DeutschDeutsche Bürger/Beschränkte sicherlich heimatliche Gefühle bekommen.